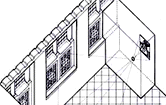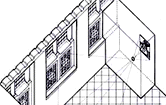
camera
obscura : - die
erfindungen zur fotografie
- 1820-1840
Das
Ikon-Magazin ist ein Teil des »Fotorama«-Netzwerks, zu dem
auch - ein
Fotomuseum gehört. In diesem »www.fotomuseum.ws«
gibt es
- eine
Folge von Galerien, die die einzelnen Phasen der Geschichte des
- Mediums
Schritt für Schritt nachvollziehen. Die ersten dieser Galerien
- sind
den Erfindungen zwischen 1820 und 1850 gewidmet, die die Foto-
- grafie
von einem Traum zu einer Realität und dann zu einem Massenme-
- dium
werden liessen.
Drei
dieser Galerien zur Frühzeit der Fotografie haben wir gleich unten
- für
Sie verlinkt. Jede der drei Galerie bietet ausführliches Text- und
Bild-
- material
zu der Erfindung, deren Namen sie trägt. Wer die Galerien be-
- sucht
und sich die Zeit nimmt, den diversen Links nachzugehen, die dort
- versammelt
sind, wird erstaunt sein, wie reichhaltig das Internet inzwi-
- schen
an Fachinformationen zur Geschichte der Fotografie geworden
- ist.
Vor allem die Zahl der abgebildeten Fotografien macht sprachlos.
- Denn
man müßte schon gehörige Summen aufwenden, um sich eine
- ähnlich
umfängliche Sammlung in Buchform reproduzierter Aufnahmen
- zuzulegen.
Von der Zeit, die das kosten würde, gar nicht zu sprechen.
In
der Frühzeit des Mediums nannte man Fotografien gern »Sonnenbil-
- der«
oder »sun pictures«. Beiden Begriffen liegt der heute kaum
noch
- bekannte
Begriff »Heliographie« zugrunde, den der Franzose Joseph
- Nicéphore
Niépce prägte. Bezeichnet hat er damit die Resultate seiner
- Bemühungen,
das Bild der Camera Obscura dauerhaft zu fixieren. So-
- weit
wir wissen, war er nicht der erste, der das versuchte; aber der
- erste,
dem es gelang. Nur war sein Verfahren so umständlich und die
- Abbildungsqualität
seiner »Heliographien« so miserabel, daß seine Er-
- findung
ein technisches Kuriosum geblieben wäre, wenn sie nicht von
- anderen
entscheidend verbessert worden wäre.
Wenn
Sie mehr über das »Heliographieren« erfahren möchten,
dann - klicken
Sie jetzt auf den blauen Pfeilbutton gleich unten.
Ein
anderer Franzose, der fast zeitgleich mit Niépce vom dauerhaften
- Fixieren
des Camera Obscura-Bildes träumte, war der Pariser Kulissen-
- maler
Jaques Mandé Daguerre, Besitzer mehrerer begehbarer Pano-
- ramen
(die zu dieser Zeit große Publikumsattraktionen waren).
Daguerre
hatte schon mehrere erfolglose Versuchreihen hinter sich, - als
er auf Umwegen von Niépce Bemühungen erfuhr. Bei einem per-
- sönlichen
Treffen beider vereinbarte man, von nun an gemeinsam vor-
- zugehen,
wobei es zuerst Daguerre gelang, die entscheidenden Ent-
- deckungen
zu machen, die die Zeit zum Herstellen einer Fotografie
- von
Stunden auf Minuten verkürzte.
Als
kluger Geschäftsmann hatte Daguerre auch die Idee, das Patent - für
dies Verfahren nicht privatwirtschaftlich auszubeuten, sondern
- dem
französischen Staat zum Ankauf anzubieten, damit dieser es der
- Öffentlichkeit
zur freien Nutzung überließ. Was 1839 geschah, dem
- Jahr,
das seither als offizielles Geburtsjahr des Mediums gilt.
Wenn
Sie mehr über das »Daguerreotypieren« wissen möchten,
so - klicken
Sie jetzt auf den blauen Pfeilbutton gleich unten.
- Seit
wir die »Daguerreotypie«-Galerie einerichtet haben, sind uns
noch
- weitere
interessante Links in die Hände gekommen. Die können Sie ein-
- sehen,
wenn Sie jetzt den blauen Pfeilbutton gleich unten klicken.
Die
Neuigkeit vom bevorstehenden Ankauf des »Daguerreotypie«-Ver-
- fahrens
durch den französischen Staat verbreitete sich wie ein Lauf-
- feuer
durch ganz Europa. In England war besonders ein Mann davon
- zutiefst
schockiert. Denn William Henry Fox Talbot hatte seit Jahren an
- einer
ähnlichen Erfindung getüftelt und sie fast bis zur praktischen
An-
- wendung
perfektioniert. Nun sah er die akute Gefahr, als Erfinder der
- Fotografie
zu spät zu kommen. In aller Eile kontaktierte er die Royal So-
- ciety,
deren Mitglied er war, um dort sein Verfahren so rasch wie mög-
- lich
publik zu machen. Wie sich herausstellte, besaß Fox Talbots Ver-
- fahren
gegenüber dem der Franzosen sogar einen wesentlichen Vor-
- teil.
Denn die Aufnahmen nach seinem ließen sich beliebig vervielfäl-
- tigen,
während die Daguerreotypien Unikate blieben.
Wenn
Sie mehr über das »Kalotypieren« nachlesen möchten,
dann - klicken
Sie jetzt auf den blauen Pfeilbutton gleich unten.