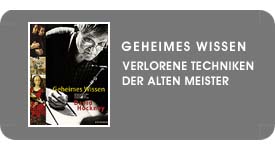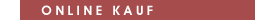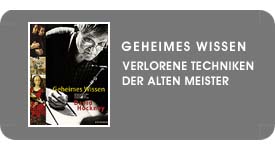
- Wiederentdeckt
von David Hockney.
- Mit
402 farbigen Abbildungen,
- 296
Seiten
- ISBN
3896600923
- Preis
: Euro 49,90 [D] / ¤ 51,30 [A] / sFr 84,

- David
Hockney, einst Mitbegründer der Pop Art und einer der be-
- deutendsten
und beliebtes-ten zeitgenössischen Maler, hat die
- großen
Meisterwerke der Kunstgeschichte unter die Lupe ge-
- nommen.
Dabei hat er eine erstaunliche Beobachtung gemacht,
- die
kein Zufall ist: Anfang des 15. Jahrhunderts, in einer relativ
- überschaubaren
Zeitspanne, bekommen die Gemälde plötzlich
- eine
Präzision und Lebendigkeit, die einen Qualitätssprung be-
- deutet.
Diese Entdeckung, von der Zunft der Kunsthistoriker bis
- heute
nicht kommentiert, ließ ihm keine Ruhe mehr. Er begann,
- eine
Vielzahl von Bildern systematisch zu untersuchen und dis-
- kutierte
seine Beobachtungen bald in einem ausgedehnten Brief-
- wechsel
mit seinem englischen Freund und Fachmann Martin
- Kemp
sowie mit anderen inter-nationalen Experten aus Kunst
- und
Naturwissenschaften. Seine Aufsehen erregende These:
- Die
Künstler hatten sich beim Malen nicht allein auf ihr Auge ver-
- lassen,
sondern optische Hilfsmittel eingesetzt. Maler wie Leo-
- nardo,
van Eyck, Holbein, Caravaggio, Velázquez und später
- auch
Ingres verwendeten Spiegel, Prismen und Linsen, die ih-
- nen
neue Möglichkeiten der Darstellung von Wirklichkeit boten.
- Es
bedurfte eines »Handwerkers« wie Hockney, um die Kunst-
- historiker
mit dieser The-se zu konfrontieren. In diesem Buch,
- das
zeitgleich mit der englischen Ausgabe erscheint, lässt uns
- Hockney
erstmals an seinen spannenden Untersuchungen teil-
- haben,
die das Geheime Wissen der Alten Meister enthüllen.
- Anhand
von umfangreichem, brillantem Bildmaterial, eigenen
- Skizzen
und einem höchst erhellenden Briefwechsel werden
- Entwicklungen
dargestellt und Argumente ausgetauscht. Der
- Leser
wird so in eine der interessantesten kunsthistorischen
- Debatten
unserer Zeit hineingezogen, die ihn in Zukunft die Al-
- ten
Meister mit neuem Vergnügen betrachten lässt. Hockney
- schlägt
darüber hinaus den Bogen in die Gegenwart, hinter-
- fragt
die Möglichkeiten der Künstler im Computerzeitalter und
- gibt
Impulse für das moderne Kunstschaffen.
- DAVID
HOCKNEY wurde 1937 in England geboren
- und
ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler.
- Der
Wahlkalifornier, der in jungen Jahren die britische Kunst-
- szene
aufrüttel-te, wird zu den Pionieren der Pop Art gezählt.
- Durch
seine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der
- Kamera
gilt Hockney heute als Innovator der Fotokunst.


- Oben
: Ein Bild von Vermeer [links] und
- eine
Nachstellung desselben, wie das
- Motiv
von einer Kamera gesehen wird -
- zum
Buch »Vermeer's Camera« weiter
- unten
erwähnt.
Natürlich
drängen sich bei Thesen, wie sie Hockney vorträgt, - die
Fragen auf: Kann das wahr sein? Und wenn ja, warum ha-
- ben
die Kunsthistoriker das von Hockney Entdeckte bislang so
- fahrlässig
verdrängt? Warum mußte es ein Künstler und wa-
- rum
konnte es kein Fachgelehrter sein, dem die von Hockney
- beschriebenen
Merkwürdigkeiten auffielen und der dann nach
- plausibelen
Erklärungen suchte?
Was
die Stichhaltigkeit von Hockneys Thesen betrifft, so darf - man
wohl schon (mit großer Vorsicht wohlverstanden) davon
- ausgehen,
daß sie grosso modo zutreffen. Ganz sicher kann
- man
erst sein, wenn die Fachgelehrten jeden Einzelfall geprüft
- haben.
Das wird noch einige Zeit dauern, aber erste Untersu-
- chungen
sind schon angestellt. So für den Fall des hollänidi-
- schen
Malers Vermeer, von dem man immer vermutet hatte,
- daß
er eine camera obscura besaß und nutzte. Philip Stead-
- man
ist dem nachgegangen und hat seine Recherchen jetzt in
- einem
Buch zusammengefaßt, zu dem es eine sehr ausführ-
- lich
Homepage gibt (siehe Link gleich unten).
Vermeers
Camera : Uncovering the Truth Behind the Master- - pieces
- by Philip Steadman
Und
wer die Reaktionen der Fachwelt auf das Buch überprü- - fen
möchte, kann unter folgende Adresse weitersehen
Camera
Obscura+Vermeer - the google.com search results
Warum
tut sich die Zunft der Kunsthistoriker so schwer, die - Einsichten
und Vermutungen, die Hockney vorträgt, überhaupt
- ernst
zu nehmen. Dafür gibt es zwei Gründe, Stolz und ideo-
- logie.
Natürlich muß ein Kunsthistoriker in seiner Berufsehre
- getroffen
sein, wenn ihm ein Laie Tatsachen aufzeigt, die er
- längst
hätte sehen und bewerten müssen. Zum anderen ba-
- siert
die Schulmeinung der Kunstgeschichte noch immer allzu
- sehr
auf dem Geniebegriff, nach dem Künstler keine Handwer-
- ker
sind, sondern begnadete Individuen, denen quasi über-
- menschliche
Fähigkeiten zur Verfügung stehen - auch beim
- korrekten
Abzeichnen nach der Natur. Zwar gibt es solche
- Zeichengenies
wirklich, aber nur ganz selten. Hockney nennt
- als
Beispiele Leornardo, Michelangelo, Rubens und Rembrandt.
- Die
anderen, weniger begabten mußten dann eben zu Hilfs-
- mitteln
greifen, um den angestrebten Realismus ihrer Darstel-
- lungen
zu erreichen. Und um festzustellen, wo die Grenze
- liegt
zwischen Darstellungen, die nur das Genie aus freier
- Hand
zu zeichnen fähig ist und leichter zu bewältigenden
- Aufgaben,
braucht es wohl erhebliche praktische Erfahrung,
- wie
sie nur ein Künstler besitzt, der sich täglich mit diesen
- Problemen
herumschlägt. Die Abneigung der Kunsthistoriker,
- die
Nutzung von Hilfsmitteln durch Künstler zuzugestehen,
- weil
sie glauben, das könne deren Ansehen mindern, ist
- freilich
auch aus dem Grund fahrlässig, weil es natürlich
- auch
bei der Nutzung von Hilfsmitteln Grade der Perfektion
- gibt,
sodaß man sagen kann, nur große Künstler wissen
- ihre
Hilfsmittel auch virtuos einzusetzen und so, daß man
- es
kaum merkt. Mehr darüber auf der Webseite zum Buch
- Hockneys
beim Kulturweltspiegel des ZDF (Link unten).
David
Hockney - Kulturweltspiegel - vom
18. November 2001
Wie
dem auch sei - die kunsthistorische Debatte um
- Hockneys
Thesen ist freilich nur eine Seite der Medaille. Die
- andere
wäre eine Debatte aus fotohistorischer Sicht. Und da-
- von
habe ich noch gar nichts gehört, obwohl Hockneys The-
- sen
dazu zwingen, die Vorgeschichte der Fotografie in neu-
- em
Licht zu sehen und neu zu schreiben.
- Vor
etlichen Jahren sorgte eine Ausstellung mit dem
- provokanten
Titel »Fotografie nach der Fotografie« für Auf-
- sehen.
Gemeint man mit dem Titel das damals neue Phänomen
- der
digitalen Fotografie. Nun haben wir auch eine »Fotografie
- vor
der Fotografie«. Und das läßt das fotografische Zeitalter
- (für
das man den Zeitrahmen von 1830 bis ca. 1990 anset-
- zen
kann) als etwas erscheinen, das nicht nur abgeschlos-
- sen
ist, sondern auch einen spezifischen Platz im Verlauf der
- abendländischen
Medien- und Kunstgeschichte einnimmt, der
- bislang
nicht so deutlich zu umschreiben war wie jetzt.
- Wenn
man Hockneys Buch ernst nimmt, so war die
- Grundtendenz
der abendländischen Tafelmalerei seit ihrem
- Auftreten
in der alt-niederländischen Malerei ein Unterneh-
- men,
daß auf möglichst realistische Widergabe von Welt ab-
- zielte.
Maßstab für diesen Realismus war das Bild, das Lin-
- sen
und die camera obscure produzierten - nach heutiger
- Diktion
also ein »fotorealistischer« Realismus. Die klassi-
- sche,
analoge Fotografie machte diesen Realismus für je-
- derman
erreichbar, der eine Kamera kaufte. Das führte zu
- einer
Krise der Malerei, soweit sie realistisch orientiert war.
- Das
Kamerabild hatte nur den Nachteil, daß quasi selbstän-
- dig
entsteht und die kompositorischen Möglichkeiten eher
- von
den technischen Parametern bestimmt sind als vom
- Bildwillen
des Kamera-Operateurs. Dem hilft erst das digi-
- tale
»Rendern« ab (das »Zeichnen« und »Malen«
im Com-
- puter).
Insgesamt erscheint das »fotografische Zeitalter«
- heute
also als jene Phase der Bildhistorie, in der der abend-
- ländische,
zentralperspektivische Realismus zwar perfek-
- tioniert
wurde, aber nur eingeschränkt realisierbar war und
- somit
fast zwangsweise zur digitalen Bildproduktion führen
- mußte,
die dem Künstler all jene Freiheiten fotorealistischer
- Weltwidergabe
eröffnet, die ihm die Malerei bietet. Fotohi-
- toriker
auf also! Es gibt wieder eine Menge zu tun.
- Mehr
zum Vergleich der Fotografie und Malerei bei
- Darstellungen
des Kriegs hatte Hockney aus aktuellem An-
- laß
kürzlich in New York zu sagen - ein weiteres Thema,
- in
dessen Diskussion sich Fotohistoriker einzumischen hät-
- ten,
wie ich meine (siehe Link unten).
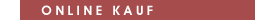
- Sie
können die »Geheimes Wissen«
in jeder Buchhandlung
- der
deutschsprachigen Länder kaufen, aber auch online
- beim
Verleger der Bandes, dem Knesebeck Verlag. Zum
- online
Kauf klicken Sie bloß auf den blauen Pfeilbutton gleich
- unten.
Der Klick bringt Sie zur Startseite des Internet-Auftritts
- von
Knesebeck, wo Sie alle weiteren Informationen zu ih-
- rer
online Bestellung finden werden.